Am 7. Mai wird mein Lehrer Wolf Schneider 90 Jahre alt. Und hat soeben seine Memoiren vorgelegt: Hottentottenstottertrottel.
Ein Stottertrottel? Der war ich fast, mit 10: Da wollte ich etwas sagen unter lauter Vierzehnjährigen – und brachte kein Wort heraus, wieder mal. Panik! Mutwillig versuchte ich das äußerste Gegenteil: Überwinde deine Angst, verblüffe sie alle, indem du den großen Zungenbrecher von 29 Silben meisterst, mit dem sie sich abends am Lagerfeuer lachend plagten! Ich trainierte heimlich, provozierte den nächsten Wettstreit im fehlerfreien Herunterrattern – und siegte! Das war der Durchbruch. Den Gewinn dieser kühnen Tat streiche ich seit achtzig Jahren ein.
(Leseprobe hier)
In diesen Tagen werden unzählige Wolf-Schneider-Erinnerungen über Wolf Schneider niedergehen, für Focus schrieb Hans-Jürgen Moritz über ihn (wenn ich mich nicht irre, 6. Lehrgang: Wir Ehemalige sind darauf geeicht, an den Namen immer gleich den Lehrgang anzukleben, hier schreibt also: Petra Reski, 7. Lehrgang) beim Tagesspiegel besprach Bernd Matthies (1. Lehrgang) Schneiders Memoiren und zitiert den schönen Satz von Jan Fleischhauer (8.Lehrgang): „Er war schon politisch unkorrekt, als es noch nicht einmal ein Wort dafür gab.“ Spiegel-Online führte ein Interview mit Wolf Schneider – und als ich die schwachsinnige und sinnentstellende SPON-Überschrift las, fühlte ich mich sofort an all die verdrucksten Journalistenschüler-Hinterbänkler erinnert, die eine ganze Karriere lang vergeblich versucht haben, sich an ihm abzuarbeiten.
Aus gegebenem Anlass habe ich meine Schneider-Hommage wieder ausgegraben, die ich 2011 für den Stern schrieb, als Wolf Schneider mit dem Henri-Nannen-Preis für sein Lebenswerk geehrt wurde:
In jenem Sommer war ich der glücklichste Mensch der Welt. Die Henri-Nannen-Schule hatte mich aufgenommen, im Herbst sollte mein Lehrgang beginnen, der siebte. An einem sonnigen Nachmittag betrat ich die Villa an der Fontenay-Allee zum ersten Mal, Wolf Schneider hatte uns ermuntert, ihn noch vor Beginn der Ausbildung zu besuchen. Zuletzt hatte ich ihn in der Auswahlkommission gesehen, als er uns skeptisch musterte. Und während der Kaffeepause vor dem Wissenstest. Da hatte ich voller Neid beobachtet, wie er mit einer hochgewachsenen, blonden Kandidatin über ihr Hobby sprach, das sie mit „Boxen“ angegeben hatte. Aufgenommen worden zu sein, ohne boxen, fliegenfischen oder jonglieren zu können – einer der Kandidaten soll der Auswahlkommission seine Jonglierkünste unter Beweis gestellt haben – erschien mir immer noch wie ein Wunder. Mit zitternden Händen hatte ich den Brief aufgerissen: „Sie haben es geschafft!“ lautete der erste Satz, mit dem Wolf Schneider uns zugleich Lektion Nummer eins erteilte: Hauptsachen in Hauptsätze!
Ich weiß nicht mehr, worüber ich an jenem Nachmittag mit ihm sprach, vielleicht habe ich versucht, meine Beiträge für Radio France Internationale in einem Nebensatz unterzubringen. Ich weiß nur noch, dass mir Schneider mit freundlicher Ungeduld zuhörte. Und mir dann den Rat gab, dringend an meiner Aussprache zu arbeiten. Die Spuren meines Ruhrgebietstonfalls zu tilgen, der dazu neige, das „R“ zu verschlucken, also Kiache statt Kirche zu sagen. Schließlich rückte er einen Stapel Zeitungsartikel in Klarsichthüllen zurecht: Die Audienz war beendet. Eine Woche später saß ich im Volkshochschulkurs „Optimieren Sie Ihre Artikulation“. Und versuchte, aus dem Unterbauch zu atmen.
Wolf Schneider war der König in unserem Reich. Die Legende. Der Übervater. Er war der witzigste, gemeinste und scharfsinnigste Lehrer, den ich je hatte. Ich liebte ihn von der ersten Sekunde an. Es hätte aber auch nichts an unserem Verhältnis geändert, wenn ich ihn gehasst hätte. Kollegin R. sagt über ihn: „Ich hasste ihn, er hasste mich. Aber ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen.“ Und Kollegin W. prägte den schönen Satz: „Wer ihn hasst, der hasst ihn auf Knien.“ Ihm allerdings ist gleichgültig, ob er geliebt oder verteufelt wird. Gleichmütig wird er all die Huldigungen, späten Abrechnungen und sentimentalen Hagiografien (Bäh, warum nicht einfach: Heiligenlegenden – würde Schneider jetzt rot an den Rand schreiben) hinnehmen, die in diesen Tagen auf ihn niederregnen, mitsamt der Ehrentitel, die ihm in den Jahrzehnten angeklebt wurden: der Sprachpapst der Deutschen, der Zuchtmeister der deutschen Sprache, der Sprachwolf.
In diesem Jahr erhält Wolf Schneider für sein journalistisches Lebenswerk den vom stern und dem Verlag Gruner + Jahr vergebenen Henri Nannen Preis. Er hat die Henri-Nannen-Schule gegründet und geleitet, 28 Sachbücher geschrieben, Bestseller über die „Titanic“, das Glück und törichte Anglizismen („Speak German! Warum Deutsch manchmal besser ist“), er hat 27 Viertausender bestiegen, als GEO-Reporter dem patagonischen Orkan getrotzt, die Psychologie des Wettrennens am Mount Everest seziert und die Riten der Papstwahl enthüllt. Er hat in 106 NDR-Talkshows bewiesen, dass ein Moderator keineswegs moderat sein muss; die Gesellschaft für deutsche Sprache hat ihn mit dem „Medienpreis für Sprachkultur“ zum Ritter geschlagen, und die Universität Salzburg ernannte ihn zum Honorarprofessor. Und er beteuert bis heute, nichts anderes vorzuhaben, als „eine Spur breiter als null“ durch das Leben zu ziehen.
In 18 Monaten wollte er uns so viel Handwerk wie möglich beibringen. Er vernichtete unsere Bandwurmsätze, lehrte uns, Zimt zu riechen anstelle von Gewürzen, und entzauberte unsere akademische Verblasenheit. Er zwang uns, den Kaiser nackt zu sehen. Auf keiner anderen Journalistenschule sollte man mehr lernen können. Wir sollten keinen Praxisschock erleiden, sondern einen Journalistenschulschock. Das klingt, als wäre die Henri-Nannen-Schule unter Schneider ein Dschungelcamp für Journalisten gewesen. Und genauso war es. Mit dem einzigen Trost, dass wir nicht rausgewählt werden konnten. Unsere gegrillten Heuschreckenlarven waren die Nachrichtenübungen, die Schneider korrigierte. Und in Blau (schlecht), Rot (unterirdisch) und, sehr selten, Grün (ganz okay so) vermerkte: Scheiße, pfui, hä? Oder: Frei erfunden! Widerlicher Quatsch! Oder: Sie sind eine Plaudertasche! Wer sich für originell hielt, las: Sie hatten einen Einfall. Aber nicht die Charakterstärke, darauf zu verzichten! Schneider war unsere Tigermutter.
Sein Geheimnis? Die vollkommene Abwesenheit von Langeweile. Und von Opportunismus. Kollegin R., die bekennende Schneider-Hasserin, sagt heute noch: „Jeder Tag mit Schneider war ein guter Tag.“ Vor allem liebten wir jene Momente, in denen nicht wir unten, sondern die oben Ziel seines Spotts waren, wenn er sich etwas zurücklehnte, die Arme hängen ließ und genüsslich Gemeinheiten über die Branche erzählte. Und nebenbei den auf seinem Stuhl kippelnden Kollegen W. ermahnte, endlich aufzuhören, Sizilien zu verwischen – weil W. mal wieder seinen Hinterkopf gegen die Weltkarte gelehnt hatte, die im Unterrichtszimmer hing.
Keine Sekunde seines Lebens war Wolf Schneider ein Einerseitsandererseits- Journalist, bei Springer flog er als Chefredakteur raus, weil er einen Kommentar gegen den chilenischen Diktator Pinochet drucken ließ, obwohl er wusste, dass Springer Pinochet schätzte. Unverdrossen schwimmt Schneider gegen den Strom, getrieben von Neugier und Ungeduld. Auch nach 64 Berufsjahren stellt er die Welt infrage, das Augenscheinliche, das Erwartbare, die Statistik und die Theorien. Und weigert sich, das Unverständliche für tiefgründig zu halten.
Bis heute hat er sich den Blick eines Autodidakten bewahrt. Als Schneider nach dem Krieg in die Universität reinhörte, stellte er fest, dass ihm sowohl Zeit als auch Lust zu einem Studium fehlten. In seiner Schulzeit habe er Philosophieprofessor werden wollen, sagte er einmal und fügte hinzu: „Dann kam der Zweite Weltkrieg dazwischen. Er schuf Abstand zur Philosophie.“ Nüchterner kann man nicht ausdrücken, wie es ist, wenn man zu einer Generation gehört, der Träume, Illusionen und Glauben weggebombt wurden. Wolf Schneider wurde 1925 geboren, er gehört somit zu denen, die der Soziologe Helmut Schelsky die „skeptische Generation“ nannte – jene Generation, die gezeichnet ist vom Misstrauen gegenüber dem Pompösen, der Propaganda und der Macht. Aber auch Schelsky ändert nichts daran, dass Schneider Soziologen für hoffnungslose Fälle hält: „Wenn man einem Geologen seine Sprache wegnehmen würde, dann blieben ihm immerhin die Steine. Aber was bleibt dem Soziologen? Nichts. Er lebt von seinem Sprachgebilde und vom Getümmel in demselben.“ Dass vereinzelt Soziologiestudenten dennoch an der Journalistenschule aufgenommen wurden, darf als Beweis für Schneiders pädagogische Effizienz gewertet werden.
Als Wolf Schneider 1995 die Henri- Nannen-Schule verließ, nach 16 Jahren und 330 Schülern in 18 Lehrgängen, fühlten wir uns etwas verwaist. Weil wir spürten, dass er die Krone leichten Herzens abgelegt hatte. Wir gehörten von nun an zu seiner Vergangenheit, nicht mehr zu seiner Gegenwart. Während wir uns noch in Schneider- Schnurren verloren, war er schon nach Mallorca gezogen, getreu seiner Devise: „Man kann nicht verhindern, dass man alt wird. Aber man kann verhindern, dass dies bei schlechtem Wetter geschieht.“ Auch wenn nicht zu befürchten war, dass der Mann sich in einen Apologeten der mallorquinischen Mandelblüte verwandeln oder einen Katalanischkurs belegen würde, schwindelte uns doch bei dem Tempo, in dem er Sprachglossen für die „Zeit“ schrieb und Kulturgeschichten für GEO. Während wir in den Redaktionen noch über dem ersten Satz brüteten, hatte Schneider auf Mallorca schon eine Weltgeschichte des Ruhms verfasst, Bestseller über große Verlierer oder das „Handbuch des Journalismus“. Er unterrichtete an Journalistenschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und stellte sich keine geringere Frage als die, warum und wie die Menschheit ihr Kapital an Können und Wissen vergeudet: Warum dauerte es 3000 Jahre, bis chinesische Lackarbeiten in Europa nachgeahmt werden konnten? Warum blieb der Schubkarren bei uns 1300 Jahre lang unbekannt? Schneiders Texte seien selten Kuschelecken, sagt GEO-Chefredakteur Peter-Matthias Gaede über seinen Lehrer, der gleichzeitig sein Autor ist. Und stellt fest: „Er konfrontiert mit virtuos ausgewählten Fakten. Er implantiert keine Herzschrittmacher, auf dass sich ein Wohlgefühl beim Leser einstelle, sondern sorgt dafür, dass es in dessen Hirn ein paar neue Kontakte zwischen den Synapsen gibt: Aha-Erlebnisse, gnadenlos genaue Blicke auf die Wirklichkeit, überraschende Erkenntnisse von Zusammenhängen, wenigstens Fragen.“ Nebenbei musste Schneider auf seinem mallorquinischen Anwesen übrigens auch noch Strom erzeugen. Angesichts seiner schier unerschöpflichen Energie bleibt allerdings die Frage, warum es dazu überhaupt noch eines Generators bedurfte.
Heute lebt Wolf Schneider am Starnberger See, wo er bei ungebremstem Tempo im nunmehr 16. Jahr seiner Freiberuflichkeit ein Leben abseits von Vorsorge und Magerquark führt: Schneider liebt Sahnetorten, guten Wein und die 50-Stunden-Woche. Er betreibt einen Videoblog: „Speak Schneider“, schreibt an seinem 29. Buch und zwiebelt weiterhin nicht nur Journalistenschüler, sondern auch Öffentlichkeitsarbeiter, Finanzfachmänner oder Kommunikationschefs – die am Ende eines Seminars bei Schneider klingen, als wären sie einem Scientologen begegnet: „Ich hatte bislang die Gelegenheit, meine Gedankenwelt weitschweifig auszubreiten. Dann traf ich Wolf Schneider.“
Die Frau, die Wolf Schneider seit 45 Jahren unverdrossen widerspricht, heißt Lilo. Dank ihr ist Schneider auf Facebook vertreten und hat eine eigene Homepage. Lilo Schneider ist Ehefrau, Lektorin, Computer-Fachfrau, Rechercheurin und „Niederarbeiterin von Widerständen“ in Personalunion. An sie muss er gedacht haben, als er den Satz prägte: „Ohne Sie bin ich nichts, mit Ihnen könnte ich alles sein!“, jenen Satz, mit dem er uns riet, bei Bewerbungsgesprächen sowohl demütig als auch stolz aufzutreten. Denn er folterte uns nicht nur, er glaubte auch an uns – oft mehr als viele Väter. Drei seiner vier Kinder und eine Enkelin wurden Journalisten. Als seine Tochter Susanne schwer erkrankt war, schrieb sie noch im Krankenhaus den ersten Satz ihrer preisgekrönten Reportage: „Wer möglichst unbemerkt auf einer deutschen Intensivstation sterben will, sollte dies gegen 14 Uhr tun.“ Alle Wechselfälle des Lebens sind nur dazu da, in Geschichten umgemünzt zu werden. Sagt Schneider.
*
Schneider-Schüler bleibt man lebenslänglich. Bis heute sitzt er uns im Genick, bei jedem Satz spüren wir seinen Atem. Und dennoch ist mir in meinem letzten Buch das Wort „Aktivitäten“ widerfahren. Was soll ich sagen, natürlich hat Schneider es bemerkt und mich im Münchner Literaturhaus zur Schnecke gemacht. („Deutsch für Profis“, Kapitel „Schludereien und Marotten“: „Aktivitäten gibt es nicht. Der Plural ist ein Anglizismus (activities). Wer ‚Aktivitäten‘ schreibt, meint überdies zumeist Aktionen, erliegt aber dem modischen Hang zur Blähung.“) Als ich mich damit zu verteidigen versuchte, dass es ein Staatsanwalt war, der das Wort benutzt hatte, sagte Schneider nur: „Gründe sind die Pest.“
Nach Lektüre meiner Hommage sagte mir Schneider übrigens, dass sie ihn gerührt habe. Was ihn aber nicht daran hinderte, im gleichen Atemzug spitz anzumerken, wie kurios es doch anmute, wenn eine Würdigung nicht mit dem zu Ehrenden beginne, sondern mit der Verfasserin.
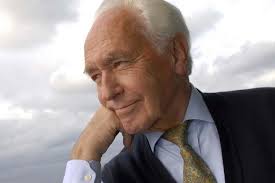
Mit Verlaub (und bei aller Hochachtung für den Jubilar und seine Schülerin): Ein Satz wie “Aktivitäten gibt es nicht. Der Plural ist ein Anglizismus (activities). Wer ‘Aktivitäten’ schreibt, meint überdies zumeist Aktionen…“ verdient m.E. nicht die dargebrachte Ehrfurcht, sondern mindestens die Randbemerkung „Quatsch“ (und zwar in Rot).
Zur Gesellschaft für deutsche Sprache: Dass Sie einen Preis dieses Vereins als Auszeichnung beschreiben (oder Herr Schneider ihn als solche erlebte), konnte ich zunächst nicht ganz einordnen, das Wort „Ritterschlag“ weckte in mir gar eine von Monty Python inspirierte Assoziation.
Das mag daran liegen, dass mich – vor allem beim Thema Anglizismen – die Statements (hehe) der GfdS in den letzten zehn Jahren immer öfter an die „Ritter der Kokosnuss“ erinnerten.
Aber dann habe ich nachgeschlagen: Herrn Schneider hat es mit der Auszeichnung ja schon 1994 erwischt (zwischen Hanns Joachim Friedrichs und Elke Heidenreich, das scheint annehmbar).